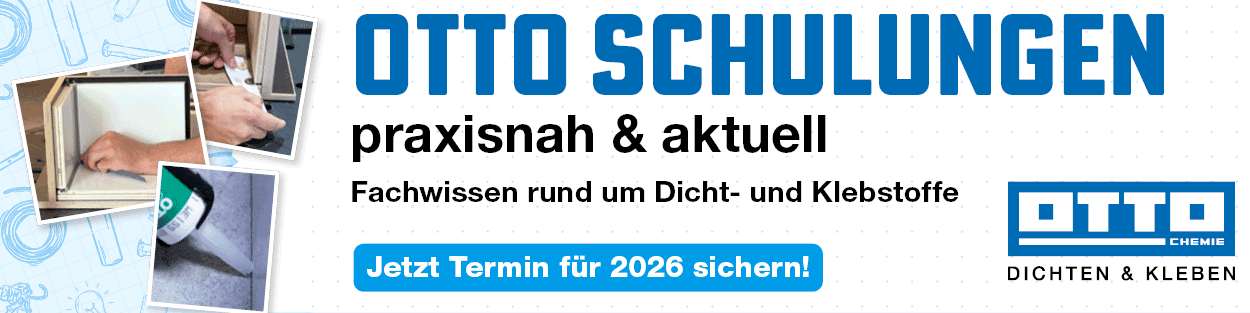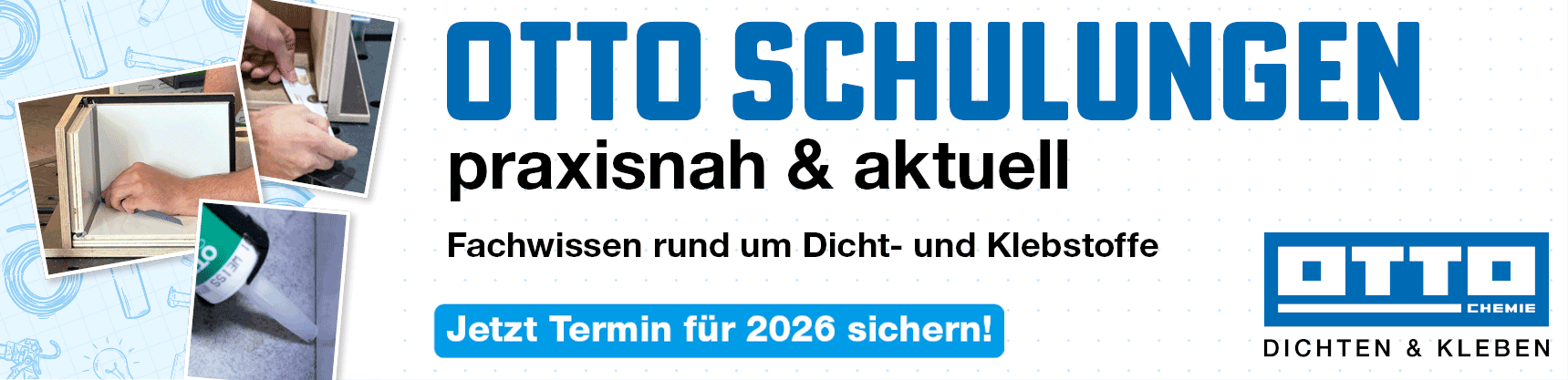Vernunft oder Wahnsinn: das R10B-Phänomen
Missverständnisse bei rutschhemmenden Fußbodenbelägen
Manchmal verdichtet sich der Eindruck, dass die gesamte Fliesenbranche nur noch über R10B spricht. Kein Hersteller, der ohne Kollektionsergänzungen mit tritt- und rutschsicherer Oberflächen auskommen mag. Kein Verleger, der sich nicht mit den zwei fast magischen Buchstaben und Zahlen gegenüber dem Kunden absichern will. Was ist dran am Hype um R10B? 1200Grad Autor Michael Spohr hat sich auf die Suche gemacht – und erstaunliches herausgefunden. Denn oh Wunder – streng genommen – gibt es R10B eigentlich gar nicht!
„Die Deutschen fragen immer sofort nach R10B“, berichtet Inma Gil, Area Managerin Mitteleuropa des spanischen Fliesenherstellers Azuvi. Sie mutmaßt, dass die deutschen Kunden das „R10B“ für eine Art Norm bei der Rutschsicherheit halten würden, „obwohl dies im Privatbereich gar nicht so wichtig ist“. Bei dem zur Argenta-Gruppe gehörenden Anbieter habe man daher entschieden dafür zu sorgen, dass die Kollektionen auch diese Rutschhemmung aufweisen würden. Azuvi steht hierbei stellvertretend für den überwiegenden Teil der Fliesenhersteller; so erfuhren wir an den Messeständen auf der diesjährigen Cersaie immer wieder, dass „diese neue Kollektion natürlich R 10 B hat“.
Im Handel begegnet man denselben Erfahrungen: Sven Cillessen von Keramundo Essen etwa bestätigt, dass fast alle Hersteller bei den Bodenfliesen R 10B-Oberflächen im Programm hätten. „Wir verkaufen fast nur noch R10B, wenn eine Dusche mit dabei ist“, berichtet der Fliesenfachberater. Und sein Kollege Carsten Stemmermann ergänzt, dass R10B nicht gleich sei bei den Oberflächen der Fliesen, die haptisch sehr unterschiedlich sein könnten. „Am besten reinigen lassen sich die R10B-Fliesen von Meissen Keramik“, so Stemmermann.
Ihre Kunden, die Fliesenleger verlassen sich hier auf die Händler und Hersteller. Holger Dietmann zum Beispiel macht klar:“ Nur wenn ich vom Hersteller oder Händler verbindlich die Info erhalte, dass die Fliese R10B hat, kann ich sie für den barrierefreien Einbau in einer ebenerdigen Dusche einsetzen“. Der seit 16 Jahren als selbständiger Fliesenleger arbeitende Dietmann aus Heiligenhaus ist früher immer auf Mosaik ausgewichen, wenn eine von ihm zu verlegende Fliese kein R10 B hatte. „Wegen der unsauberen Fugen will das aber heute kaum mehr jemand, obwohl es mit einer Epoxidharz-Verfugung gar kein Problem geben würde“, berichtet Dietmann. Er übrigens schleift grundsätzlich die Schnittflächen und Kanten bei allen Fliesen am Boden, der später barfuß begangen werden wird – „um einen scharf geschlagenen Hau“ zu vermeiden.
Und auch die Architekten verlangen in ihren Ausschreibungen immer wieder Bodenfliesen mit entsprechender R10B-Einstufung. „Wir schreiben im Nassbereich unserer Hotelbäder generell R10B aus“, erklärt Tülay Sandalci von Lindner Hotels. Im Vorflur würde R9 verlegt, aber im Badbereich eben R10B. Dies bestätigt Innenarchitektin Ulrike Wallauer: „Im Badbereich und bei Duschen auf jeden Fall steht in meinen Ausschreibungen immer R10B“. Ihr wäre es nur lieber, „wenn es durchgängig glatte Zahlen“ gebe und nicht zusätzlich zu den Zahlen 9 bis 13 auch noch die Buchstaben A, B und C.

Barfuß oder Lackschuh
Dies ist allerdings deshalb nicht möglich, weil es – streng genommen – R10B eigentlich gar nicht gibt! Bei R 10 handelt es sich um eine Rutschhemmklasse in mit Schuhen begangenen Räumen, bei B um eine Rutschhemmklasse in barfuß begangenen Räumen. Lediglich in Räumen, die sowohl mit Schuhen als auch barfuß betreten werden – in Hotelbädern beispielsweise – müssen beide Anforderungen erfüllt sein. Wahrscheinlich stammt daher die Kombination, die sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert hat. Was genau hinter den beiden Einstufungen steckt, wo sie gelten und für welche Bereiche: Darüber herrschen gleich mehrere Missverständnisse.
Sinnvoll sind Forderungen nach einem rutschhemmenden Fußboden natürlich schon. An der Spitze der Unfallstatistik der gesetzlichen Unfallversicherung liegen nämlich seit vielen Jahren Unfälle auf Fußböden. Mit rund 35 % aller Fußbodenunfälle machen dabei Ausrutschunfälle bei betrieblichen Tätigkeiten den weitaus größten Anteil aus – gefolgt von Unfällen durch Stolpern, Umknicken und Fehltreten mit 20 bis 25 %. Ursache dieser Unfälle ist häufig eine unzureichende, nicht an den vorhandenen Rutschgefahren orientierte Rutschhemmung der Bodenbeläge. Und da von den Einflussgrößen Boden, Schuh und Mensch am zuverlässigsten der Boden beeinflusst werden kann, haben die Berufsgenossenschaften die Anforderungen an die Rutschsicherheit von Fußböden in Arbeitsräumen, Arbeitsbereichen und betrieblichen Verkehrswegen geregelt.
Wo ist welche Rutschhemmung erforderlich
Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.5 Fußböden (letzte Neufassung vom März 2022) unterscheidet dabei fünf „Bewertungsgruppen der Rutschgefahr (R-Gruppen)“ von R 9 bis R 13. Hinzu kommen in Räumen mit besonders hoher Rutschgefahr noch vier V-Gruppen, die den Verdrängungsraum eines Bodenbelages kennzeichnen, geordnet nach einer Kennzahl für das Mindestvolumen des Verdrängungsraumes von 4 bis 10, gemessen in Kubikzentimeter je Quadratdezimeter.
Die ASR A1.5 führt in ihrem Anhang auch aus, in welchen Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen die Böden welche R-Einstufung und gegebenenfalls welche V-Gruppe aufweisen müssen. R 10 ist beispielsweise für Umkleide- und Waschräume erforderlich, während in Toilettenräumen – entgegen landläufiger Meinung (auch vieler Architekten) – seit einigen Jahren R 9 ausreicht. Dies gilt allerdings nur für „allgemeine Arbeitsräume und -bereiche“. In Bädern hingegen müssen die Böden auch in Einzel- und Sammelumkleideräumen R 10 aufweisen.
Bei Küchen und Speiseräumen kommen die Böden in Speiseräumen, Gasträumen und Kantinen einschließlich der Serviergänge mit R 9 aus, während in Theken- und Schankbereichen, Auftau- und Anwärmküchen, Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Garni-Hotels und Stationsküchen R 10 verlangt ist. Geht es weiter in gastronomische Küchen, Aufbereitungsküchen und Großküchen, so muss der Boden eine R 12-Rutschhemmung aufweisen. Übrigens ist hier nicht durchgängig V 4 vorgeschrieben, sondern nur in den Spülräumen der oben aufgeführten Küchen.
Prüfverfahren auf der schiefen Ebene
Skurril wird es, wenn man nachliest, wie denn ein Bodenbelag, also beispielsweise eine keramische Fliese, eingestuft wird. Dafür legt der Hersteller (oder derjenige, der eine Prüfung in Auftrag gibt) eine einen Meter lange und mindestens 40 Zentimeter breite Prüffläche – je nach Fliesenformat mit entsprechenden Fugen – an. Diese Fläche wird mit (Achtung: stimmt wirklich) Motorenschmieröl bestrichen. Dann geht eine – gesicherte (siehe Foto) – Prüfperson mit ganz genau vorgeschriebenen Prüfschuhen vorwärts und rückwärts über diese Prüffläche.

Währenddessen wird die Prüffläche aus dem waagerechten Zustand so lange weiter geneigt, bis „die Prüfperson nicht mehr sicher gehen kann und zu rutschen beginnt“. Der dann auf der schiefen Ebene erreichte Neigungswinkel ergibt die Rutschklasse der Fliese; bei R10 ist dies bei einem sogenannten Akzeptanzwinkel von mehr als 10 bis maximal 19 Grad der Fall. Die Barfußprüfung funktioniert ebenso, nur dass als Prüflösung 29 Grad (+2°) warmes Wasser mit einem geringen Anteil schaumarmer, nichtionischer Tenside verwendet werden muss. Um eine Verunreinigung durch Körperfette/-öle zu vermeiden, darf dieses Wasser immer nur einmal benutzt werden. Eine B-Einstufung erreicht ein Prüfbelag hierbei im Winkel zwischen 18 und 23 Grad.

Für die Prüfverfahren ist europaweit seit 2021 die DIN EN 16165 zur Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften von Fußböden zuständig (ersetzt unsere nationalen Prüfnormen DIN 51097, DIN 51130 und DIN 51131 zur Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften teilweise bzw. vollständig). Die neue Norm beschreibt sehr ausführlich die Prüfungsdurchführung (z.B. Schrittfrequenz und Ermittlung des Punktes des Ausrutschens) sowie Berechnung des Prüfwertes. Neu ist auch, dass in Abhängigkeit vom Prüfwert nach jeder Begehungsreihe des Prüfbelages auch der passende Standardbelag begangen werden muss. Dies ist für das anschließende Verifizierungs- und Korrekturverfahren nötig, um den individuellen Korrekturwert zu ermitteln.
Um einen Belag „vor Ort“ zu prüfen, wurden verschiedene Geräte gebaut, denen jedoch allen gemeinsam ist, dass ab der Bewertungsgruppe R10 keine Möglichkeit zur nachträglichen Überprüfung mit Gleitreib-Meßmethoden besteht. Allerdings kann mit diesen Geräten und einem alternativen Bewertungssystem eingeschätzt werden, ob die Rutschhemmung des Bodens unter Betriebsbedingungen ausreichend ist.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Anwendung der ASR- und der GUV-Regeln sich auf solche Arbeitsräume, Arbeitsbereiche und betriebliche Verkehrswege beschränkt, deren Fußböden nutzungsbedingt bzw. aus dem betrieblichen Ablauf heraus mit gleitfördernden Stoffen in Kontakt kommen, die eine Gefahr des Ausrutschens darstellen. Auf trocken genutzte Fußböden und solche ohne gleitfördernde Stoffe finden sie keine Anwendung. Dies gilt selbstverständlich auch für die neue ASR A1.5. Und schließlich sind die Merkblattvorgaben im privaten Nutzungsbereich natürlich ebenfalls nicht relevant.
Aber Achtung: Da Richter im Streitfall bei einem privat entstandenen Schaden durch Ausrutschen oder Stolpern keinerlei gesetzlichen Maßgaben vorfinden, neigen sie dazu, sich bei ihren Urteilen an den Arbeitsschutzregeln zu orientieren.
Anmerkungen
Das Arbeitsschutzrecht regelt die Anforderungen an die rutschhemmenden Eigenschaften von Fußböden. Dabei gibt es derzeit zwei (technische) Regeln, die dies beinhalten: Zum einen die DGUV Regeln 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (wurde umbenannt ist aber inhaltsgleich zur BGR/GUV-R 181) sowie 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“, welche von den Unfallversicherungsträgern herausgegeben werden und zum anderen die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.5 „Fußböden“, die zur Konkretisierung der Arbeitsstättenverordnung dient; Herausgegeben wird sie vom Ausschuss für Arbeitsstätten unter Federführung des BMAS auf Grundlage der ArbStättV als staatliche technische Regel. Bei der ersten Veröffentlichung der ASR A1.5 in 2013 wurden wesentliche Inhalte der DGUV-Regel 108-003 übernommen, so dass derzeit zwei Regeln existieren, die im Wesentlichen das gleiche regeln. Die Rangfolge zwischen den Regeln ist klar definiert: In den Vorbemerkungen der DGUV-Regel steht: Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.
Arbeitsstättenrichtlinien sind ein Teil des Arbeitsschutzes, der das Ziel hat, die Gesundheits- und Unfallgefahren auf ein Maß zurückzuführen, das nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand möglich und gleichzeitig vereinbar ist mit den Interessen der Wirtschaft an einer – aus ihrer Sicht – optimalen Nutzung der Technik. Die Arbeitsschutzrichtlinie gehört im Arbeitsschutzsystem Deutschlands zu den staatlichen Vorschriften, zusammen mit der Arbeitsstättenverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz, d. h. sie wird durch staatliche Organe auf ihre Einhaltung hin überwacht; bei den ASR sind hierfür die Gewerbeaufsichtsämter der Länder zuständig.
Der Vollständigkeit halber soll hier noch erwähnt werden, dass in bestimmten Arbeitsräumen oder -bereichen wegen des Anfalls besonderer gleitfördernder Stoffe für die dortigen Bodenbeläge ein Verdrängungsraum unterhalb der Gehebene erforderlich ist. Dies wird durch den Buchstaben „V“ in Verbindung mit der Kennzahl für das Mindestvolumen des Verdrängungsraumes gekennzeichnet; siehe DIN 51130 „Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene“. In der DIN EN 16165 wird nur noch das Verfahren zur Messung des Verdrängungsraumes beschrieben, die Messung selber aber wurde nicht in die neue Norm übernommen. Sie wird deshalb in Deutschland national geregelt. Dazu ist bereits der Normentwurf E DIN 51133 erschienen, nach dem aus Sicht der Unfallversicherungsträger bereits geprüft werden kann.
Auch die Klassifizierung der Barfuss-Prüfergebnisse in die Klassen A (geringste Rutschhemmung), B und C (höchste Rutschhemmung) aus der alten DIN 51097 gibt es nicht mehr in der neuen EN 16165. Deshalb hat die deutsche Version (DIN EN 16165) einen nationalen Anhang NB erhalten, in dem die bisherige Klassifizierung wiedergegeben wird. Diese wird analog zur bisherigen DIN 51097 übernommen.
Bei angrenzenden Fußböden treten Unterschiede in der Rutschhemmung auf, die nach ASR A1.5 nicht zu Stolper- oder Rutschgefahren führen dürfen. Dies kann als gegeben angesehen werden, wenn maximal eine R-Gruppe Unterschied auftritt. Bei einer deutlich erkennbaren und für die gehende Person erwartbaren Änderung der Rutschhemmung – beispielsweise bei einem Türdurchgang oder Tordurchfahrt – kann jedoch auch ein Unterschied von maximal zwei R-Gruppen zulässig ist. Um Übergänge zwischen verschiedenen Rutschhemmungen zu schaffen, können Übergangsbereiche eingerichtet werden, die in ihrer Länge in Gehrichtung mindestens 1,5 Meter groß sein müssen. Diese können fest eingebaut sein, oder auch durch gegen Verschieben gesicherte Fußbodenauflagen realisiert werden.


Die in diesem Artikel behandelten technischen Regeln und Merkblätter (DGUV-Regeln 108-003 und 207-006, ASR A1.5 sowie GUV-I 8527) können im Internet eingesehen, bestellt oder kostenlos heruntergeladen werden.