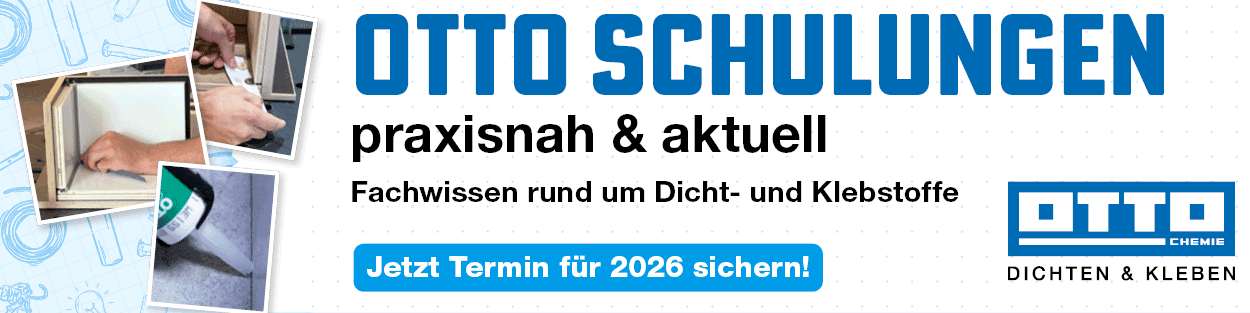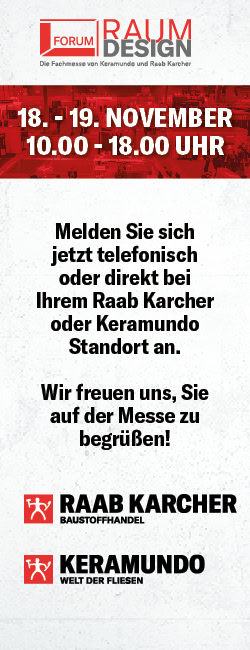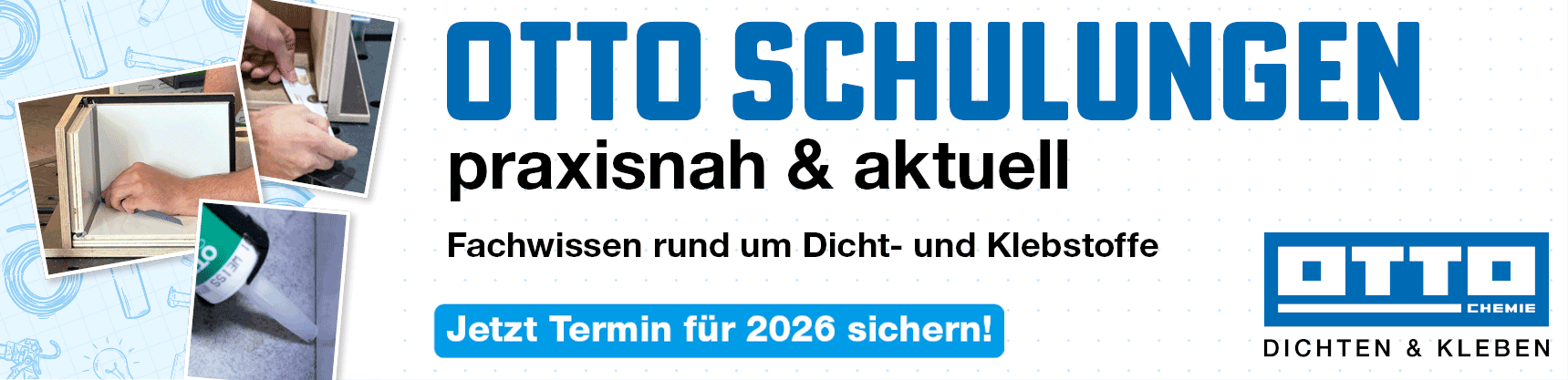Keramik am Haus: Mehr als nur „Fassade“
Keramische Beläge verbinden zeitgemäße Fassadengestaltung mit konstruktivem Gebäudeschutz
Von Thomas-Ken Ziegler, Anwendungstechnik/ Gruppenleiter Innendienst Sopro Bauchemie GmbH
Die Fassade eines Hauses – das ist viel mehr als nur eine funktionale Gebäudehülle. Fassadenflächen gestalten Gebäude. Sie sind das markante Aushängeschild eines Bauwerks und verleihen den ersten Eindruck für den Betrachter. Ob in Form von klassischen Riemchen als Spaltklinker oder attraktiver Feinsteinzeugplatten – keramische Oberflächen verbinden auf eine ideale Weise zeitgemäße Fassadengestaltung mit konstruktivem Gebäudeschutz.
Speziell in Bezug auf keramische Fassaden gibt es in Deutschland ein klares Nord-Süd-Gefälle. Je weiter man in den Norden Deutschlands kommt, desto geprägter sind die Stadtbilder von keramischen Fassaden. Im Süden sind sie dagegen deutlich seltener. Dabei hat Keramik gegenüber anderen Fassadenmaterialen eine ganze Reihe sowohl konstruktiver, als auch gestalterischer Vorteile. So sind keramische Fassaden unter anderem:
- hoch witterungsbeständig und UV-stabil;
- farbecht und nicht brennbar;
- blendfrei;
- langlebig sowie
- unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und äußerst pflegeleicht.
Temperatur als zentraler Beanspruchungsfaktor
Einer der wesentlichen Beanspruchungsfaktoren für keramische Fassadenflächen ist das Außenklima, hier insbesondere die Temperatur. In diesem Wechselspiel bekommt die Farbe einer Fassadenfläche eine ganz prägende Rolle. Bekanntermaßen heizen sich dunkle Flächen bei Sonneneinstrahlung im Vergleich zu hellen Oberflächen deutlich stärker auf. Im Rahmen einer bei der Sopro Bauchemie in Wiesbaden durchgeführten Versuchsreiche konnte festgestellt werden, dass sich unter gleichen hochsommerlichen Witterungsbedingungen eine anthrazitfarbene Keramikfläche an einer Fassade um knapp 20°C mehr erwärmte als eine hellbeigefarbene keramische Oberfläche. Diese 20°C bedeuten übrigens über eine Länge von 1,0 m eine zusätzliche Wärmeausdehnung des keramischen Materials von immerhin 0,12 mm. In gleichem Versuch zeigte sich, dass die Temperatur an der Fassade mit zunehmender Höhe abnimmt. Demnach ist sie in Bodennähe am höchsten. Bei 38,9 °C Lufttemperatur sind dies bis zu 66,6°C auf der Oberfläche der anthrazitfarbenen Keramik. Aber schon in 3 m Höhe nimmt die Oberflächentemperatur um rund 4°C ab, was sich vermutlich mit den hier vorhandenen Luftbewegungen erklären lässt.
In diesem Zusammenhang wurde weiterhin festgestellt, dass die Oberflächentemperatur auch vom Fassaden-Untergrund abhängt. Wird die Keramik beispielsweise unmittelbar auf einem Wärmedämmverbundsystem verlegt, so fehlt es an Möglichkeiten, die Wärmeenergie an den Untergrund abzuführen. Demgegenüber leitet ein mineralischer Untergrund, etwa in Form von Beton, die Wärmeenergie von der Oberfläche ab. Bei der hellbeigen Keramik konnte so die Temperatur um 11°C reduziert werden, bei der anthrazitfarbenen Keramik sogar um fast 20°C. Neben der Temperatur gibt es natürlich noch eine Reihe von weiteren Faktoren, welche die Fassadenflächen beanspruchen. Zu nennen sind hier insbesondere Windlasten, Nässe und Frost.
Die unterschiedlichen keramischen Materialien im Vergleich
Bei keramischen Fassaden lassen sich Wesentlichen zwei verschiedene Arten von Keramiktypen unterscheiden: Zum einen sind dies die klassischen Riemchen als Spaltklinker. In der Formatgröße sind diese überschaubar; denn die Standardformate variieren in der Regel nur in der Höhe zwischen 50 mm und 75 mm sowie und in der Breite zwischen 210 mm und 290 mm. Typisch für diese Materialien ist ihre hohe Porenstruktur und somit auch eine entsprechend raue Rückseite, auf der der Kleberautrag erfolgt.
Auf der anderen Seite stehen die keramischen Beläge aus Feinsteinzeug. Typisch für diese ist ihre große Format- und Designvielfalt. In der Tendenz sind diese bedeutend größer als die oben erwähnten Riemchen. Ein Format von 300 mm x 600 mm ist hier ein übliches Maß. Zudem sind die Feinsteinzeugplatten extrem dicht gesintert. Der Vorteil der dichten Sinterung liegt auf der Hand: Es ist die hohe Festigkeit und die dichte Struktur. In dieser dichten Struktur liegt allerdings auch die Herausforderung bei der Verklebung des keramischen Materials. Da diese Platten keine Porenstruktur bieten, in welcher ein Kleber sich mechanisch verkrallen kann, muss der Kleber seinerseits über ein besonderes Adhäsionsvermögen verfügen, um hier den Verbund dauerhaft sicherstellen zu können. Dies bedingt dann wiederum die Verwendung von Zementklebern mit hoher Kunststoffvergütung.
In diesem Zusammenhang ist auch die normative Basis zu betrachten, in deren Rahmen man sich bei keramischen Fassaden bewegt. Hier ist in erster Linie die DIN 18515 „Außenwandbekleidungen – Grundsätze für Planung und Ausführung – Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten“ zu nennen. Diese Norm setzt enge Grenzen, insbesondere in Bezug auf die Arten der anwendbaren Keramiken und auch die Untergründe. Bedingt, durch die normativen Vorgaben an die Mindestporigkeit sowie an die Formatgrößen (maximale Kantenlänge 0,49 m, bei maximaler Fläche von 0,12 m²) werden hier beispielsweise alle größeren Keramikformate aus Feinsteinzeug faktisch ausgeschlossen. Dies gilt auch viele Untergrundsituationen, da hier keine Wärmedämmungen oder Trockenbauelemente zulässig sind. Hierzu folgender Hinweis: Mit Keramiken bekleidete Wärmedämmverbundsysteme sind zwar inzwischen gang und gäbe, benötigen in Deutschland aber stets eine bauaufsichtliche Zulassung im Gesamtsystem. Wird in Details von diesem Gesamtsystem abgewichen, etwa durch die Verwendung von Feinsteinzeugplatten im Format 30 x 30 cm anstatt eines im System geprüften Spaltklinkers, verfällt auch hier die bauaufsichtliche Zulassung. Vor dem Hintergrund der Vereinfachung und Anpassungen an die heutigen Anforderungen wurde seitens des DIN im Jahr 2018 ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, mit dem Ziel die DIN 18515 zu modernisieren und flexibler zu gestalten.

Wichtig: Die richtige Verklebung der Keramik an der Fassade
Die eingangs aufgezeigten Beanspruchungen haben gezeigt, welche, meist temperaturbedingte Spannungsverhältnisse bei keramischen Fassadenkonstruktionen vorliegen können. Es ist daher sinnvoll, die Verklebung der Keramik stets unter Verwendung von solchen Klebern vorzunehmen, welche so konzipiert sind, dass sie eine hohe Flexibilität aufweisen und damit spannungskompensierend wirken. Ausdruck findet die Flexibilität eines Fliesenklebers in der Qualifizierung nach der DIN EN 12004. Kleber der höchsten Güte weisen hier die Kennung „S2“ auf, wie beispielsweise der Sopro megaFlex TX MEG 667.
Elementare Grundlage für die Verklebung von Keramiken an Fassaden ist generell die Erzielung einer möglichst hohlraumfreien Bettung. Dies bedingt geradezu zwingend die Anwendung des kombinierten Verfahrens. Der Kleber wird dabei sowohl auf die Rückseite der Keramik, als auch auf den Klebeuntergrund aufgetragen. Soweit handwerklich möglich werden so Hohlräume im Kleberbett vermieden. Dies ist nicht nur aus dem Aspekt eines guten Haftverbunds relevant. Dieses Vorgehen dient auch der Vermeidung von späteren Ausblühungserscheinungen oder auch eines mikrobiellen Befalls. Denn dort, wo in der Unterkonstruktion Hohlräume vorliegen wird stets Wasser gespeichert. Aber gerade dieses Wasser fördert das Auftreten der letztgenannten Erscheinungen. Deswegen gilt es Hohlräume im Kleberbett – soweit wie dies handwerklich möglich ist – konsequent zu vermeiden.
Konzeptionell ist der Sopro megaFlex TX MEG 667 durch seine Rezepturbasis, einem ternären Bindemittelsystem mit OPZ-Technologie, so aufgebaut, dass speziell das Thema möglicher Ausblühungen bei diesem Produkt bei sachgerechter Anwendung keine Rolle spielt. Dem gegenüber stehen Produkte, welche nicht in dieser Art ternär aufgebaut sind, sondern auf der Basis Portlandzement fußen. Portlandzementbasierte Zementstrukturen enthalten in der Regel einen hohen Anteil an Calciumhydroxid, welches im Kontakt mit CO2 aus der Umgebungsluft zu dem als harte Kruste auszumachendem Kalkstein (Calciumcarbonat) reagiert. Es handelt sich hier um einen Effekt, welcher in der Betontechnologie häufig erwünscht ist, aber natürlich im Zusammenhang mit der Optik keramischer Oberbeläge unbedingt vermieden werden sollte. Auch wenn er nie ganz auszuschließen ist, so kann er doch durch technische Maßnahmen (Vermeidung von Hohlräumen, Verwendung von ausblühfreien Produkten wie Sopro megaFlex TX MEG 667) weitgehend verhindert werden.
Fugenmörtel und ihre Funktion an der Fassade
Eine elementare Funktion kommt bei der Herstellung keramischer Fassaden auch dem Fugenmörtel zu. Denn erst durch die Anwendung des Fugenmörtels entsteht eine kompakt geschlossene, stark wasserabweisende Oberfläche. Der Fugenmörtel ist daher ein elementarer Bestandteil der Konstruktion und sichert so deren Dauerhaftigkeit. Ein Verzicht auf eine Verfugung würde dazu führen, dass der Kleber und die gesamte Unterkonstruktion über alle Maßen mit Wasser beansprucht wird. Dies wiederum führt in der Folge zu schweren Schäden, die insbesondere durch Frosterscheinungen entstehen. Dazu zählen vor allem Auswaschungen und Ausspülungen. Aber auch Haftverbundstörungen, Ausblühungen und Ausblutungen, sowie Rissbildungen und Abplatzungen an der Keramik sind in der Regel die Folge. Das Verfugen der keramischen Fassadenflächen ist also eine unbedingte Notwendigkeit. Gleichzeitig muss aber der Fugenmörtel noch ein ausreichendes Potential aufweisen, um auftretende Spannungen zu kompensieren. Gut geeignet sind hier die Sopro FlexFuge plus FL plus (zur Anwendung im Schlämmverfahren) oder die Sopro MeisterFuge breit MFb (zum Verfugen mit dem Fugeisen).

Bewegungsfugen in der Fassadenbekleidung
Grundsätzlich müssen natürlich auch die vorhandenen Dehnfugen aus der Unterkonstruktion deckungsgleich in der Fassadenbekleidung übernommen werden. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Spannungsbelastungen die unmittelbar an der Oberfläche der Konstruktion auftreten, ist es allerdings notwendig, zusätzliche Kompensationsfugen als Dehnfugen im Oberbelag anzulegen. Diese sind analog zu den Regeln der Technik notwendigerweise anzulegen bei:
- über vorhandenen Gebäudetrennfugen im Untergrund;
- in allen Eckbereichen;
- als Feldbegrenzungsfugen (im Keramikbelag bis auf die Unterkonstruktion) in Höhe der jeweiligen Geschosse;
- als Anschlussfugen zwischen der Außenwandbekleidung und Bauteilen mit anderen Ausdehnungskoeffizienten wie z. B. Fenster- und Türzargen, Fensterbänke, Betonteile oder Ähnliches sowie
- bei Feldlängen über 5 m.